- Deckblatt
-
Editorial
-
Was ist das: Synthese?
| | -
Praefrontal
-
Nichts existiert ohne Vermittlung
beleuchtet den Zusammenhang von Synthese und Kommunikation -
„Alternative Fakten“: Wahrheit, Lüge – Synthese
Ein Plädoyer für unverständige Vernunft | -
Synthesen und Mathematik
versucht mathematische Methoden als Synthese zu interpretieren -
Zur Natur des Menschen
erklärt die Möglichkeiten eines normativen Begriffs
-
Nichts existiert ohne Vermittlung
- Treibstoff
- Internationale Perspektiven
-
Vom Wesen der Dinge
-
Kann uns Kunst die Brille aufsetzen?
über Performance als Möglichkeit eines Auswegs aus der Verdinglichung des Subjekts -
Wie sollen uns digitale soziale Plattformen beeinflussen?
träumt von besseren sozialen Netzwerken -
Synthese des Lebens
stellt die Fortschritte in der Origin-of-life-Forschung dar -
Für eine empirisch informierte Wirtschaftsethik
| Zwischen empirischer Rechtfertigung und moralischer Orientierung
-
Kann uns Kunst die Brille aufsetzen?
- In die Werkstatt
- Die Maschine
- Literatur
- Neue Wege
Wie sollen uns digitale soziale Plattformen beeinflussen?
Bessere Wege zur Manipulation
Die Neuentwicklung digitaler sozialer Plattformen birgt großes Potential, unsere Gesellschaft grundlegend zu verändern. Es gibt bereits Plattformen mit enormer Reichweite, so etwa Facebook mit fast zwei Milliarden Nutzern. Wenn eine solche Plattform mit jeder Nutzung einen Teil unserer Aufmerksamkeit lenkt, könnte sie in der Summe einen erheblichen Einfluss auf unser Denken haben. Wäre ein solcher Einfluss gut oder schlecht? Was soll eine digitale soziale Plattform leisten können und was nicht?
Man kann tatsächlich den Anspruch haben, dass digitale soziale Plattformen Menschen zusammenbringen sollen, um mithin eine Synthese der Interessen ihrer Nutzer zu ermöglichen. Das hieße, die Menschheit – oder zumindest ein Teil davon – sollte sich über solche Plattformen koordinieren und verstehen und das fördern, was der Gemeinschaft als Ganzes wichtig ist. Die Synthese müsste sich dabei nicht nur auf die Niedlichkeit von Katzenvideos beschränken, sondern könnte auch zwischenmenschliche Umgangsformen, Moralvorstellungen, Politik sowie die Wahrnehmung des Weltgeschehens beinhalten. Eine Plattform wie Facebook leistet hier jedoch wenig. Denn das Bilden von Gemeinschaft setzt auch gemeinsame Prinzipien voraus. Bei Facebook geht es jedoch nicht darum, essentielle gemeinsame Werte zu finden. Vielmehr bekommt der einzelne Nutzer dort eine individuelle Abfolge an Nachrichten gezeigt, die von Facebook so ausgewählt wurden, dass er möglichst oft auf den Like-Button drücken wird. Durch diese klickoptimierende Vorgehensweise werden die Weltbilder der einzelnen Nutzer isoliert ausgeprägt statt zusammengeführt. Trotz dieses Fehlens einer Herausbildung gemeinsamer Prinzipien seiner Nutzer hat Facebook selbst klare Prinzipien für den Umgang mit seinen Nutzern. Dadurch ist Facebook mehr als ein wertneutrales, rein technisches Kommunikationswerkzeug. Denn schließlich hat das Unternehmen das Ziel, durch Marketing Geld zu verdienen (Geld, das es nicht mit seinen Nutzern teilt). Um Menschen durch zu verkaufende Werbeleistung beeinflussen zu können, ist die oben beschriebene Isolierung der Nutzer in gut identifizierbare Gruppen und Einzelindividuen mit klaren Interessenprofilen gerade von Vorteil. So kann Facebook den Werbekunden, also Unternehmen, die dort Werbeplätze kaufen, treffsicher gewünschte Zielgruppen anbieten. Trotz der Möglichkeit, bei Facebook 5000 Freunde zu haben, können die Nutzer tatsächlich mehr isoliert als zusammengebracht werden, wenn sie ihre Zeit auf dieser digitalen sozialen Plattform verbringen.1
Ich träume von der Schaffung grundlegend neuer digitaler sozialer Plattformen. Solche, die mehr die Synthese gemeinschaftlicher Interessen ermöglichen. Doch nach welchem Prinzip sollte diese Synthese stattfinden? Welche Synthese durch digitale soziale Plattformen ist gut und welche ist schlecht? Welche Moralphilosophie wäre dafür geeignet? Für wegweisend halte ich Immanuel Kants Idee des kategorischen Imperativs, dessen grundlegendes Prinzip ist: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde
2. Bei Kant führt dieser kategorische Imperativ zu einer praktischen Philosophie, mit der Menschen sich disziplinieren können. Eine Plattform, die solch eine praktische Philosophie umsetzt, fände ich erstrebenswert.
Doch der Programmierer einer Plattform wird es schwer haben, eine praktische Philosophie auszuwählen, die von allen Nutzern akzeptiert wird. Deswegen muss der kategorische Imperativ jedoch nicht gleich verworfen werden. Meine Idee ist, dass ein größeres Kollektiv der Nutzer der Plattform besser in der Lage ist, diese Aufgabe zu bewältigen. Um das Potential des Nutzerkollektivs auszuschöpfen, müsste man eine digitale soziale Plattform so programmieren, dass sie das gemeinschaftliche Entwickeln und Etablieren einer praktischen Philosophie begünstigt. Dies wäre ein Ansatz, für den man die Art und Weise beeinflussen müsste, wie Menschen denken und kommunizieren. Im Folgenden werde ich einen Maß-stab für die Eignung digitaler sozialer Plattformen definieren, die bei einer selbstständigen Umsetzung des kategorischen Imperativs helfen.
Das halte ich deshalb für wichtig, weil die Struktur einer jeden Kommunikationsplattform das Denken ihrer Nutzer verändert. Somit trägt der Programmierer eine nicht unerhebliche Verantwortung, arbeitet er doch in seine Software gewissermaßen das Menschenbild ein, auf dessen Basis der Computer operiert. Dadurch wird bereits vorstrukturiert, wie im Betrieb mit Menschen interagiert wird und wie sie beeinflusst werden.
In meinem Informatikstudium habe ich intensiv gelernt, wie man Software möglichst zum Funktionieren bringt. Wenn es jedoch darum geht, zu lernen, wie man darüber reflektiert, welche Funktion für eine Software überhaupt wünschenswert ist und welche nicht, finde ich, dass zumindest (reine) Informatiker von unserem Bildungssystem dabei so gut wie keine Hilfe bekommen. Da gerade bei digitalen sozialen Plattformen die Macht, Designentscheidungen zu treffen, schnell in den Händen von Informatikern liegt, möchte ich als junger Informatiker mit diesem Artikel daran arbeiten, das Defizit bei der Suche nach Maßstäben zu verringern.
Für diese Aufgabe muss ich notwendigerweise ein bestimmtes Menschenbild voraussetzen. Denn immer, wenn man etwas programmiert, das irgendwie von Nutzen sein soll, muss zunächst ein Modell der Wirklichkeit konzipiert werden. In diesem Fall soll ein Computerprogramm mit Menschen umgehen können. Dazu muss es ein Modell geben, was ein Mensch ist. Dieses Menschenbild muss notwendigerweise stark vereinfachend sein, weil es sich sonst mangels Ressourcen (in Bezug auf Rechenkapazität und Speicherplatz) nicht in Software umsetzen ließe.
Das allgemeinste Menschenbild, das ich als naiver Informatiker immer voraussetzen würde, sieht den Menschen als wahrnehmendes, informationsspeicherndes, informationsverarbeitendes und handelndes Wesen. Dabei fasse ich den Begriff „Information“ möglichst breit und allgemein auf. Obwohl noch genauer eingeschränkt und definiert werden könnte, was alles „Information“ sein soll, und welche Arten von Informationen es geben könnte, ist dies für meine folgenden Überlegungen nicht notwendig. Mein Menschenbild ist daher keine vollständige Beschreibung, sondern eine allgemeine Schablone. Würde ich mit meiner Schablone ein Computerprogramm beschreiben, würde ich mit „Information“ nicht nur die Programmvariablen und den Input meinen können, sondern auch den Quellcode, das Rechnermodell sowie die Struktur der Hardware. Nach dieser Betrachtungsweise könnten in Bezug auf den Menschen dann auch Dinge wie Kniereflexe, Strukturen des Denkens, Gefühle sowie die Anordnung der Knochen als „Informationen“ bezeichnet werden. In meinen allgemeinen Gedankengängen werde ich dann verschiedene Informationen mit einer abstrakten Eigenschaft differenzieren, deren Existenz ich aus meinen theoretischen Überlegungen heraus vermuten werde (siehe unten „Persistenzordnung“). Mit meinem philosophischen Interesse stelle ich nun fest, dass der Mensch (mindestens) folgende zwei Grundbedürfnisse hat:
- Informationsbedürfnis: Der Mensch möchte stets gewisse Informationen angenommen haben.
- Fokussierungsbedürfnis: Der Mensch möchte stets nur begrenzt Informationen angenommen haben.
Mit „Annehmen einer Information“ meine ich, dass ein Mensch die Information verhaltenswirksam speichert. Insofern betrachte ich den Menschen in Bezug auf sein Verhalten, was für mich diejenige Funktion ist, die sein potentielles Handeln unter allen möglichen Umständen beschreibt. Interessant sind dahingehend nur Informationen, die er auf solche Weise speichert, dass sie einen Einfluss auf sein Verhalten haben. Das Informationsbedürfnis ist nun deshalb wichtig, weil der Mensch ohne Annahme jeglicher Information eine leere Hülle wäre, meinungsleer und handlungsunfähig. Das Fokussierungsbedürfnis ist hingegen wichtig, da der Mensch bei Annahme von zu vielen Informationen in einem Chaos vielfältiger Denkstrukturen und widersprüchlicher Meinungen versinken würde und ebenfalls handlungsunfähig wäre. Das bedeutet, dass sie sich nicht beide Grundbedürfnisse gleichzeitig unbegrenzt erfüllen lassen. Jeder Mensch muss sie jedoch irgendwie in Einklang bringen.
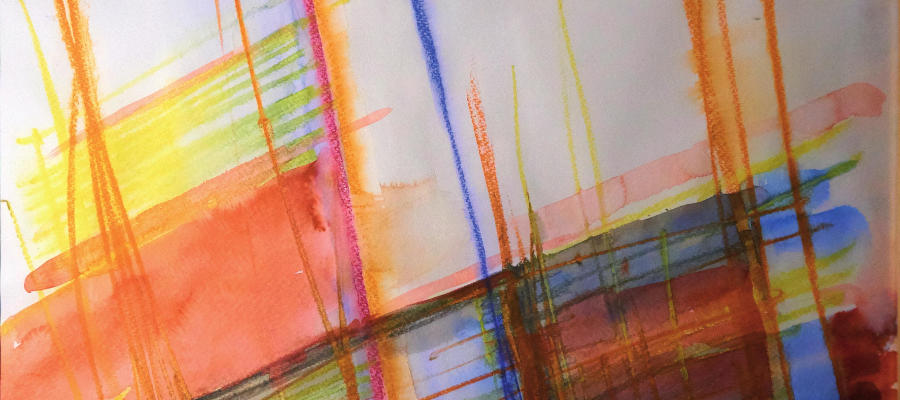
Doch wie ist das möglich? Ich kann das nur erklären, wenn ich mein Menschenbild erweitere. Es muss für jeden Menschen eine Ordnung geben, die es ihm ermöglicht, Informationen zu gewichten. Ich denke nicht, dass dies eine totale Ordnung sein muss, in der jede Information miteinander verglichen werden kann. Aber mindestens möchte ich eine partielle Ordnung annehmen, in der einige Informationen relativ zueinander verglichen werden können. Diese Ordnung soll im Folgenden Persistenzordnung genannt werden. Sie ermöglicht es, vorzugsweise Informationen mit hoher Persistenz anzunehmen sowie auf Informationen mit niedrigerer Persistenz eher zu verzichten. So könnte es zum Beispiel sein, dass es jemandem schwieriger fällt, sein generelles Hunger-Bedürfnis zu ändern als seine Lust auf Schokoladenkuchen. Dann wäre das Hunger-Bedürfnis höher in der Persistenzordnung als das Verlangen nach Schokoladenkuchen. Oder diejenige Information, welche die Struktur ist, die das Verwenden von Sätzen in einer Sprache ermöglicht, muss in der Ordnung höher angesiedelt sein als ein bestimmter Satz in dieser Sprache. Denn wenn man die Struktur, welche es ermöglicht, den Satz zu denken, verliert, kann man auch den Satz nicht mehr als Information annehmen (deswegen ist die Struktur mindestens so schwierig zu ändern wie der einzelne Satz und somit persistenter). Das Informationsbedürfnis verlangt nun insbesondere die Annahme solcher Informationen, die in der Ordnung weiter oben sind, das heißt, die eine höhere Persistenz aufweisen. Um dem Fokussierungsbedürfnis nachzukommen, könnten dann primär Informationen reduziert werden, die niedriger in der Ordnung sind, das heißt eine geringere Persistenz haben.
Wie stark die beiden Bedürfnisse gewichtet sind, kann sich von Mensch zu Mensch und situativ unterscheiden. Digitale soziale Plattformen haben hier Einfluss auf ihre Nutzer. Daran, in welchem Verhältnis eine Plattform die beiden Grundbedürfnisse bei ihren Nutzern fördert, kann man meines Erachtens messen, wie sehr eine Plattform ihren Nutzern beim Bilden einer praktischen Philosophie gemäß dem kategorischen Imperativ hilft. Das heißt, je stärker das Fokussierungsbedürfnis gewichtet wird, desto eher wird ein kategorischer Imperativ ermöglicht. Eine extreme Gewichtung des Fokussierungsbedürfnisses könnte sogar dem kategorischen Imperativ entsprechen. Denn um zuverlässig und eindeutig nur nach derjenigen Maxime zu handeln, von der man möchte, dass sie ein allgemeines Gesetz werde, muss man begreifen, was diese Maxime ist. Das gelingt umso besser, je abstrakter man sich auf die dafür wesentlichen Informationen im Sinne einer Gemeinschaft fokussiert. Zweifelsohne ist für das Programm Kants eine gewisse „Wahrheitsfähigkeit“ praktischer Fragen notwendig, für die es zahlreiche Begründungsansätze gibt.3 Für mich genügt es jedoch, anzunehmen, dass die Begründung einer „richtigen“ praktischen Philosophie möglich sein könnte. Ich frage mich lediglich, auf welche Art und Weise die Nutzer einer digitalen sozialen Plattform denken müssten, um einer solchen praktischen Philosophie näher zu kommen. Das Fokussierungsbedürfnis stärker zu gewichten, als es in unserer Gesellschaft bisher üblich ist, halte ich auch dann für erstrebenswert, wenn es für den kategorischen Imperativ noch nicht ausreichend getan würde. Ich fordere also eine abgeschwächte Form des kategorischen Imperativs.
Die Plattform Facebook führt seine Nutzer weit weg von einem solchen Ideal. Denn das Informationsbedürfnis wird dort in zu extremem Maße gefördert. Die Menschen werden regelrecht dazu erzogen, Änderungen in ihrem Denken nur bei Informationen mit möglichst niedriger Persistenz zuzulassen. Unter anderem über den Like-Button versucht Facebook, das Weltbild seiner Nutzer in Erfahrung zu bringen und zu festigen. Mit diesem Wissen sollen die Nutzer dann durch Marketing – in üblicherweise den unteren Bereichen ihrer Persistenzordnung – zur Annahme neuer Informationen gebracht werden. Das ist jedoch keine Reduktion der Menge an insgesamt angenommener Information. Eine solche erfordert eine Fokussierung auf das Wesentliche.

Quelle: geralt, CC0 Public Domain: https://pixabay.com/de/facebook-augen-modell-mädchen-frau-695108
Mein Maßstab, das Fokussierungsbedürfnis stärker zu gewichten, hat direkte Implikationen für das Design digitaler sozialer Plattformen. Situativ und je nach Nutzer müsste die Gewichtung der beiden Grundbedürfnisse bewusst und möglichst kontrolliert beeinflusst werden (eine Beeinflussung würde schließlich in jedem Fall ohnehin stattfinden). Dafür müsste wohl zunächst in irgendeiner Form versucht werden, die individuellen Persistenzordnungen sowie die aktuelle jeweilige Gewichtung der Grundbedürfnisse zu erfassen. Dabei müsste für jeden Nutzer in Hinblick auf ausreichende Erfüllung seines Informationsbedürfnisses dessen Fokussierungsbedürfnis gestärkt werden, indem die Menge an insgesamt angenommenen Informationen minimiert würde. Das hieße, die handlungswirksam gespeicherten Informationen so umzustrukturieren helfen, dass mit weniger Annahmen das Informationsbedürfnis gleichermaßen gestillt bliebe.
Im Besonderen wird es bei den Nutzern einer sozialen Plattform das Bedürfnis nach gemeinsamer Annahme von Informationen geben. Das ist zum Beispiel der Fall beim Sprechen über Fakten oder bei der Suche nach Regelungen für das Zusammenleben. Die Art und Weise, wie die Kommunikation zwischen den Nutzern verläuft und wie sehr sich auch in den höheren Bereichen der jeweiligen Persistenzordnungen Anknüpfungspunkte und Übereinstimmungen bilden lassen, beeinflusst, wie viele zusätzliche Annahmen die Individuen treffen müssen, um dem Bedürfnis nach gemeinsamer Information nachzukommen.
Der Schlüssel wird sein, dass Nutzer sich in der Interaktion miteinander gegenseitig bei der Fokussierung auf das Wesentliche helfen. Im Idealfall könnten so allgemeine Gesetze im Sinne des kategorischen Imperativs gefunden werden. Unter anderem wäre es denkbar, Begründungs- und Argumentationsmechanismen zu verwenden, um Selektion nach wenigen anerkannten Kriterien zu ermöglichen. Dies umzusetzen wäre eine Herausforderung.4 Zunächst sollte jedoch die Formulierung eines Maßstabes der Erörterung seiner technischen Umsetzung vorangehen.
Je mehr die uns umgebenden Kommunikationsstrukturen dafür sorgen, dass unsere begrenzten Kapazitäten an Aufmerksamkeit mit für uns Unwichtigem ausgelastet werden, desto weniger können wir uns auf das gemeinsame Wesentliche konzentrieren. Jegliche Gemeinschaft mit dem Ziel einer Synthese menschlicher Interessen wäre dann im Rauschen individueller Unwichtigkeiten handlungsunfähig oder von einzelnen Egoismen dominiert.
- Severin Engelmann, The Digital Dimensions of Personal Identity. An Analysis of Facebook’s User Interface and Audience Targeting Application, Master’s Thesis an der TU München (2017).
- Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Walter de Gruyter. Akademie-Ausgabe Kant Werke IV (1968), 421.
- Jürgen Habermas, Philosophische Texte Band 3: Diskursethik (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2009), 31.
- Paul Lorenzen, Normative Logic and Ethics (Mannheim, 1969).

Feedback